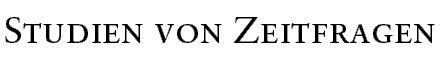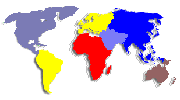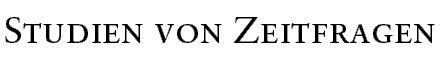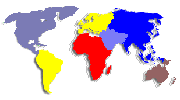|
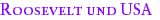 
Zeitfrage Roosevelt
New Deal oder nur ein neuer Dealer?
Auch eine Einführung zum Tagebuch von Henry A. Wallace 1945 „Into the Cold War“
Von David Hartstein
„Freilich, wenn wir Vergangenes wahrheitsgemäß erzählen, holen wir aus der Erinnerung nicht die Dinge selbst hervor, die vergangen sind,
sondern nur Worte, die die Bilder wiedergeben, die jene Dinge im Vorübergehen durch die Sinne dem Geiste wie Spuren eingeprägt haben. ...
Aber weder jene Morgenröte, die ich am Himmel sehe, ist der
Sonnenaufgang, obwohl sie ihm voraufgeht, noch diese Vorstellung in meinem Geiste. Doch muß ich diese beiden gegenwärtig sehen, um den künftigen Aufgang vorauszusagen. Das Zukünftige also ist noch
nicht, und wenn noch nicht, dann überhaupt nicht, und wenn es nicht ist, kann es auch durchaus nicht gesehen werden. Aber es kann vorausgesagt werden auf Grund des Gegenwärtigen, das bereits ist
und das man sieht.“ Augustinus, vor sechzehn Jahrhunderten
Lord Black, British citizen Conrad M. Black, Medienmagnat, hält Pech in seinen Händen. Seinen Konzern Hollinger International und die propagandistischen Schlachtschiffe, mit denen er im
angloamerikanischen Geistesraum mit den Phantasmen der Tories als Kompaß kreuzte, darf er nicht mehr lenken, weil ihm kleinliche Aktionäre zuviel persönliches Wirtschaften
nachgewiesen haben und die finanzielle Unerschütterlichkeit des Propagandakomplexes von Daily Telegraph bis Jerusalem Post in Zweifel steht.
Noch mehr Pech widerfuhr ihm mit dem Versuch, das Leben Franklin D. Roosevelts in einem voluminösen biographischen Gespinst aus den meisten, wenn auch nicht allen, wichtigen
Quellen über Roosevelt mit den Schnörkeln eines High Tory auf dem Papier zusammenzuschnüren. Nach der Rezension in der New York Times von Michael Janeway (Professor für Journalismus
und Kunst and der Columbia University New York; Autor des Buches „The Fall of the House of Roosevelt: An Education in Influence and Ideas from FDR to LBJ“; Erscheinen April 2004?)
verwandelt Blacks biographische Kompilation den Patriziersohn aus Hyde Park in einen Lord Springwood, womit er auch diese dreimal wiedergewählte amerikanische Geschichtsperson, wie
sich selbst, gelandet sein läßt - auf einem und in einem „landed estate“.
Weder Black noch seinem Rezensenten läßt die Frage Ruhe, ob Roosevelt ein großer Mann der Geschichte war. Mehr noch, es wird gefragt: wie tiefgehend er ein Idealist, der Echte, oder wie
sehr er ein Opportunist, ein Poseur gewesen sei?
Für sein Buch über Roosevelt als Champion of Freedom hat sich Black von Thomas Carlyle und dessen Theoremen über die großen Männer der Geschichte belehren lassen. Von diesem
erhabenen Engländer läßt sich viel, aber doch nicht alles über Idealismus lernen. Er hatte gewähnt, von Friedrich Schiller fast alles dazu sich einverleiben zu können, während er das Leben
dieses Dramatikers der Universalgeschichte verstehend beschrieb. Hatte er wirklich geglaubt, aus dem Briefwechsel mit Goethe heraus den Mann zu verstehen, dessen Einbildungskraft
und Bildungsgesetz Goethe selbst nur unter Aufbietung aller Freundschaft antizipieren konnte. Hatte Carlyle wahrhaft verstanden, welches Schillersche Spiel sich hier in dem ersten
Gespräch zwischen den beiden nach einer Sitzung der Jenaer Naturforschenden Gesellschaft vollendete:
„Wir gelangten zu seinem Hause, das Gespräch lockte mich hinein; da trug ich die Metamorphose der Pflanzen lebhaft vor, und ließ, mit manchen charakteristischen Federstrichen, eine
symbolische Pflanze vor seinem Auge entstehen. Er vernahm und schaute das alles mit großer Teilnahme, mit entschiedener Fassungskraft; als ich aber geendet, schüttelte er den Kopf und
sagte: das ist keine Erfahrung, das ist eine Idee. Ich stutzte, verdrießlich einigermaßen: denn der Punkt, der uns trennte, war dadurch aufs strengste bezeichnet. Die Behauptung aus ‚Anmut
und Würde‘ fiel mir wieder ein. Groll wollte sich regen, ich nahm mich aber zusammen und versetzte: das kann mir nur lieb sein, daß ich Ideen habe ohne es zu wissen und sie sogar mit Augen sehe.“ (Juli 1794)
Idealismus ist, so mag der niemals dieser Art ausgesprochene Friedens- und Freundschaftsschluß zwischen Schiller und Goethe gelautet haben, die Idee in die Erfahrungswelt mit der klarsten
Bestimmtheit hineinsehen und gleichzeitig als wahr und vernünftig vernehmen. Entdeckt sich hier das
Geheimnis Deutschland, des Landes der Dichter und Denker?
Vermutlich nicht für Carlyle, der für den Rest seines Lebens dieses Moment des Subjekts in Gang und Geschichte des Geistes nur als Kategorie der Romantik weiterbehandeln konnte.
Roosevelt Idealist?
Idealismus bemächtigte sich auch Lincolns, als er das Moment von Gettysburg in aller Bestimmtheit als und für das Werden der
amerikanischen Nation aussprach: Dichtung und Gedanke sprechen aus einem Subjekt in einem Fall. Sie bilden das Subjekt, das im Individuum des Advokaten zum Vorschein kommt.
Nirgendwo findet sich das Heraufkommen dieses Momentes besser beschrieben als im Buch des Schülers Alexander von Humboldts, John William Draper, in „Der amerikanische Bürgerkrieg“ (Leipzig 1877).
Der Advokat Roosevelt, Vorkämpfer der vier Freiheiten, ein Idealist? Der sich keinem Land gegenüber so viele Irrtümer und edle Lügen erlaubt hat wie gegen Deutschland? Da sollten
deutsche Augen so genau wie möglich hinsehen, um den prozessierenden Widerspruch, der Vereinigte Staaten von Amerika heißt, mindestens zu erkennen.
W. Averell Harriman, der geheime Sonderbotschafter in FDRs Weltdiplomatie zwischen Moskau und London, ist ein beredter Zeitzeuge, auch wenn er gern seine nicht unmaßgebliche
Beteiligung am Gerangel um den Einzug Hitlers in die Reichskanzlei der Republik von Weimar verschwiegen hat. Gegenüber Roosevelt ist er auch der Vertreter und Aufseher der
Geldoligarchie, die seit dem Ende des amerikanischen Bürgerkrieges die demokratische Republik in Schach hält. (W. Averell Harriman, In geheimer Mission, Seewald Verlag Stuttgart-Degerloch 1979)
In Harrimans Aufzeichnungen liest man im Kapitel „Lieber eine bequeme Oase als das Floß bei Tilsit“, wie es zur Aufstellung der Forderung nach bedingungsloser Kapitulation kam. Dort äußerte
Roosevelt unter anderm zu Churchill:
„Manche der Briten unter ihnen kennen die alte Geschichte: Wir hatten einen General namens U.S. Grant; er hieß Ulysses Simpson Grant, aber in meiner Jugend (und der des
Premierministers) wurde er ‚Unconditional Surrender‘ (bedingungslose Kapitulation) Grant genannt. Die Eliminierung der deutschen, japanischen und italienischen Kriegsmacht
erfordert die bedingungslose Kapitulation von Deutschland, Italien und Japan. Mit ihr ist der zukünftige Weltfrieden einigermaßen gesichert. Das bedeutet nicht, daß die
Bevölkerung von Deutschland, Italien oder Japan vernichtet werden soll, sondern nur, daß in diesen Ländern die Philosophien ausgelöscht werden, die sich auf die Unterwerfung und Unterdrückung anderer Völker stützen.“
Auslöschung von „Philosophien zur Unterwerfung und Unterdrückung anderer Völker“ durch die schleichende Totalisierung des Bombenterrorkrieges? Hatte er das gemeint,
wußte er, was er da als Präsident verantwortete - welche neue Ära des Kriegs durch Terror gegen die Bevölkerung damit begann? Ahnte er gar, daß er damit der Totalisierung des Krieges, die
Goebbels brauchte, propagandistische Werkzeuge ins Maul schob?
Im Kapitel über die Konferenz von Teheran kommt zur Kenntlichkeit, was der Verwandte des Theodor Roosevelt, des ersten wirklich imperialistischen Präsidenten der USA, und wie er
über das Volk der Dichter und Denker bestimmen wollte. Harriman hat die Stimmung der Neuaufteilung der mitteleuropäischen Karte und die Neuausteilung der Karten aufgezeichnet:
„Roosevelt schloß sich dieser Stimmung an, die es so sehr begünstigte, Linien durch die Karte Europas zu ziehen, und sprach davon, Deutschland in fünf separate Staaten aufzuteilen:
1. Preußen, das ‚so klein und schwach wie möglich gemacht‘ werden solle.
2. Hannover und Nordwestdeutschland.
3. Sachsen und das Gebiet von Leipzig.
4. Hessen-Darmstadt, Hessen-Kassel und das Gebiet südlich
des Rheines.
5. Bayern, Baden und Württemberg.
Die Ruhr und das Saarbecken, Deutschlands wichtigste Kohle- und Stahlproduzenten, sollten unter die Kontrolle der Vereinten
Nationen gestellt werden. Auch für das Gebiet des Nord-Ostsee-Kanals und Hamburgs müsse eine internationale Verwaltung eingesetzt werden.“
Darauf eine Reminiszenz Harrimans.
„Er hatte mir diese Idee lange vor Teheran mitgeteilt“, schrieb Harriman. „Roosevelt hatte in Deutschland studiert und glaubte deshalb, besonders viel von dem Thema zu verstehen. Ich hielt
wenig von dem Gedanken, Deutschland aufzusplittern. Der Plan war nicht durchdacht und schien mir zu drastisch; nach meiner Meinung war der deutsche Nationalismus zu stark und würde
die geteilten Staaten wieder zusammenbringen. Roosevelt träumte wieder einmal laut“.
Roosevelt als Imperator
Kaminträumerei? Was unterschied diesen Präsidenten, der nach Harriman in Deutschland studiert haben soll und dort allenfalls das Tirieren Talleyrands und Castlereaghs beim Wiener Kongreß
als Pensum aufgenommen zu haben schien, (nicht jedoch, welche geschichtlichen Volkskräfte den Sieg über Napoleon ermöglicht hatten - nicht zuletzt die seit der Begegnung Goethes
und Schillers gewachsenen Kräfte der Nation Deutschland -) von einem Dealer beim Black Jack? Diese Frage kann uns Lord Black gewiß nicht beantworten. Aber mit solchen neuen Linien auf der
Karte Europas wäre dieser kanadische Bürger, der sich zum High Tory und Historiker emporgehoben wähnte, samt seiner gesellschaftlichen, politischen und intellektuellen Entourage, über
die der ehemalige Mitarbeiter Brzezinski munter plaudert, hoch zufrieden gewesen.
Es gab sehr wohl einen Unterschied, den das von den Nationalsozialisten besetzte und besessene und von Premierminister Churchill und Amerika im Krieg um die
Beherrschung Europas bekämpfte Deutschland erst am Tage der Kapitulation begreifen und erlernen wollte und bis heute gegen jede Zumutung der USA nach dem 8. Mai 1945 in Erinnerung behalten hat: den Roosevelt des New Deal, die Vier Freiheiten,
den Versuch des Neu-Beginnens mit der amerikanischen Republik. Selbst wenn die Geschichts- und Persönlichkeitsdeuter FDR nur den Ruhm eines begnadeten opportunistischen Poseurs ließen,
so hätte er dennoch dies ausgesprochen und damit den Vorspruch, das Versprechen der amerikanischen Verfassung neu ausgesprochen:
„Charity – in the true spirit of that grand old word. For charity, literally translated from the original, means love, the love that understands, that does not merely share the wealth of the
giver, but in true sympathy and wisdom helps men to help themselves.
We seek not merely to make government a mechanical implement, but to give it the vibrant personal character that is
the very embodiment of human charity.
We are poor indeed if this nation cannot afford to lift from every recess of American life the dread fear of the unemployed that
they are not needed in the world. We cannot afford to accumulate a deficit in the books of human fortitude.
Governments can err, Presidents do make mistakes, but the
immortal Dante tells us, that Divine justice weighs the sins of the cold-blooded and the sins of the warm-hearted in different scales.
Better the occasional faults of a government that lives in the
spirit of charity, than the consistent omissions of a government frozen in the ice of its own indifference. ... To some generation, much is given. Of other generations, much is expected. This
generation of Americans has a rendezvous with destiny.“ FDR upon renomination as Presidential candidate 1936.
Der Mann, der dies 1936 für seine Nominierung zur ersten Wiederwahl als Präsident zum demokratischen Konvent sagte, war 1944 unter den Bedingungen der Käfteverhältnisse in seiner
Partei und bei den amerikanischen Wählern insgesamt zu sehr ingeniöser Opportunist und Poseur und zugleich zu schwach, um im Angesicht seines abzusehenden Ablebens seinen einzigen
wirklichen Geistesbruder Henry Wallace in Kabinett und Partei als seinen Vizepräsidenten und damit als seinen baldigen Nachfolger durchzusetzen. In der Demokratischen Partei dagegen setzte
sich der Rückschlag gegen Gettysburg durch; die imperiale Oligarchie, die amerikanischen Tories wiederum brauchten Roosevelt als Imperator nur noch bis zum völligen Sieg im
Weltkrieg, darüber hinaus hatten sie für die Ziele der Neuordnung der Weltverhältnisse zwischen den Staaten, Völkern und Klassen, das von Wallace proklamierte „Zeitalter des
gemeinen Mannes“ keine Verwendung mehr. Letzten Endes hatte der Oberbefehlshaber Roosevelt somit seinen Krieg umsonst gewonnen. - Auch den gegen das Deutschland Hitlers.
Und den Willen zum Sieg über die Not ist dieser Kriegsheld schuldig geblieben, weil er in einem entscheidenden Moment, 1944, zu sehr der selbstgefällige demokratische politische
Poseur war, der die Bestimmung („destiny“) der Abstimmung unterordnete. „Regierungen können irren, Präsidenten begehen Fehler, doch der unsterbliche Dante sagt uns, daß die göttliche
Gerechtigkeit die Sünden der Kaltblütigen und die Sünden der Warmherzigen in verschiedenen Waagschalen wägt.“ Was der kaltblütige Politiker versäumt hat, läßt sich in den Tagebuchaufzeichnungen von Henry Agard Wallace aus den Jahren 1944-46 nachlesen.
Druckversion 
Leserbrief 

|